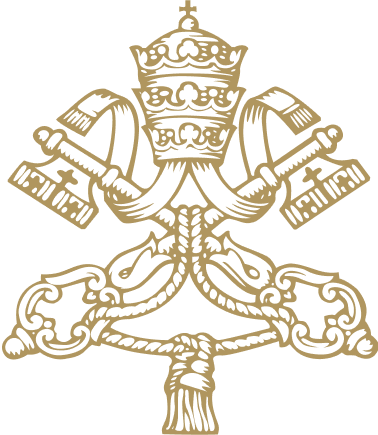BOTSCHAFT VON PAPST FRANZISKUS
AN DIE TEILNEHMER DER VOLLVERSAMMLUNG
DER PÄPSTLICHEN AKADEMIE FÜR DAS LEBEN
[3.-5. März 2025, Konferenzzentrum Augustinianum]
____________________
Liebe Mitglieder der Akademie,
es ist mir immer eine Freude, mich an die Frauen und Männer der Wissenschaft zu wenden, ebenso wie an diejenigen in der Kirche, die den Dialog mit der wissenschaftlichen Welt pflegen. Gemeinsam können Sie der Sache des Lebens und dem Gemeinwohl dienen. Und ich danke Erzbischof Paglia und den Mitarbeitern ganz herzlich für ihren Dienst an der Päpstlichen Akademie für das Leben.
Auf der diesjährigen Generalversammlung wollen Sie sich mit dem Thema befassen, das heute als »Polykrisis« bezeichnet wird. Es betrifft einige grundlegende Aspekte Ihrer Forschungstätigkeit im Bereich des Lebens, der Gesundheit und der Fürsorge. Der Begriff »Polykrise« verweist auf die Dramatik der historischen Situation, in der wir uns derzeit befinden und in der Kriege, Klimawandel, Energieprobleme, Epidemien, Migrationsphänomene und technologische Innovationen zusammentreffen. Die Verflechtung dieser kritischen Themen, die gleichzeitig verschiedene Dimensionen des Lebens berühren, führt uns dazu, das Geschick der Welt und unser Verständnis von ihr zu hinterfragen.
Ein erster Schritt besteht darin, unser Verständnis von der Welt und dem Kosmos genauer zu untersuchen. Wenn wir dies nicht tun und wenn wir unseren tiefsitzenden Widerstand gegen Veränderungen nicht ernsthaft analysieren, sowohl als Einzelne als auch als Gesellschaft, werden wir weiterhin das tun, was wir mit anderen Krisen getan haben, auch mit den jüngsten. Denken wir an die Covid-Pandemie: Wir haben sie sozusagen »verschenkt«; wir hätten uns mehr um die Veränderung des Bewusstseins und der sozialen Praktiken bemühen können (vgl. Apostolisches Schreiben Laudate Deum, 36).
Und ein weiterer wichtiger Schritt, um nicht in unseren Gewissheiten, Gewohnheiten und Ängsten zu verharren, besteht darin, den Beiträgen der Wissenschaft aufmerksam zuzuhören. Das Thema des Zuhörens ist entscheidend. Es ist eines der Schlüsselwörter des gesamten synodalen Prozesses, den wir eingeleitet haben und der sich nun in der Umsetzungsphase befindet. Ich schätze es daher, dass Ihre Vorgehensweise dessen Stil widerspiegelt. Ich sehe darin den Versuch, in Ihrem spezifischen Bereich jene »soziale Prophetie« zu praktizieren, der sich auch die Synode verschrieben hat (Abschlussdokument, 47). In der Begegnung mit Menschen und ihren Geschichten und im Hören auf wissenschaftliche Erkenntnisse wird uns bewusst, wie sehr unsere Parameter in Bezug auf Anthropologie und Kulturen einer tiefgreifenden Revision bedürfen. Dies war auch der Ursprung der Intuition der Studiengruppen zu bestimmten Themen, die während des Synodenprozesses entstanden sind. Ich weiß, dass einige von Ihnen zu diesen Gruppen gehören und auch die Arbeit der Akademie für das Leben in den vergangenen Jahren einbringen, für die ich sehr dankbar bin.
Das Hören auf die Wissenschaften eröffnet uns ständig neue Erkenntnisse. Wenn man bedenkt, was sie uns über die Struktur der Materie und die Entwicklung der Lebewesen sagen, ergibt sich ein viel dynamischeres Bild der Natur, als man zu Newtons Zeiten dachte. Unser Verständnis der »permanenten Schöpfung« muss überarbeitet werden, in dem Bewusstsein, dass nicht die Technokratie uns retten wird (vgl. Enzyklika Laudato si’ , 101): Sich der utilitaristischen und neo-liberalen planetarischen Deregulierung zu beugen bedeutet, das Recht des Stärkeren als einziges Gesetz aufzuzwingen; und das ist ein Gesetz, das entmenschlicht.
Als Beispiel für diese Art von Forschung können wir Pater Teilhard de Chardin und seinen – sicherlich unvollständigen und unvollendeten, aber gewagten und inspirierenden – Versuch anführen, ernsthaft in einen Dialog mit den Wissenschaften zu treten, und dabei Transdisziplinarität einzuüben. Ein riskanter Weg, der ihn dazu brachte, zu sagen: »Ich frage mich, ob es nicht notwendig ist, dass jemand den Stein in den Teich wirft – ja, dass er ›getötet‹ wird, um den Weg frei zu machen«1. So begann er seine Intuition zu entwickeln, die sich auf die Kategorie der Beziehung und Interdependenz zwischen allen Dingen konzentrierte und den Homo sapiens in enge Verbindung mit dem gesamten System der Lebewesen stellten.
Diese Art, die Welt und ihre Entwicklung zu interpretieren, mit den noch nie dagewesenen Möglichkeiten, mit ihr in Beziehung zu treten, kann uns Zeichen der Hoffnung geben, die wir als Pilger in diesem Jubiläumsjahr suchen (vgl. Bulle Spes non confundit, 7). Die Hoffnung ist die Grundhaltung, die uns auf unserem Weg trägt. Sie besteht nicht darin, resigniert abzuwarten, sondern sich mit Schwung dem wahren Leben zuzuwenden, das weit über die engen Grenzen des Einzelnen hinausführt. Wie Papst Benedikt XVI. in Erinnerung gerufen hat, ist die Hoffnung »an das Mitsein mit einem ›Volk‹ gebunden und kann nur in diesem Wir für jeden einzelnen Ereignis werden« (Enzyklika Spe salvi, 14).
Auch wegen dieser gemeinschaftlichen Dimension der Hoffnung werden wir angesichts einer komplexen und globalen Krise dazu angehalten, Instrumente mit globaler Reichweite zu schätzen. Leider müssen wir eine zunehmende Irrelevanz der internationalen Gremien feststellen, die auch durch kurzsichtige, auf den Schutz partikulärer und nationaler Interessen ausgerichtete Haltungen untergraben werden. Dennoch müssen wir weiterhin entschlossen »wirksamere Weltorganisationen vorsehen, die mit der Autorität ausgestattet sind, das weltweite Gemeinwohl, die Beseitigung von Hunger und Elend sowie die wirksame Verteidigung der Menschenrechte zu gewährleisten« (Enzyklika Fratelli tutti, 172). Damit wird ein Multilateralismus gefördert, der nicht von den wechselnden politischen Umständen der Interessen einiger weniger abhängig ist und eine stabile Wirksamkeit hat (vgl. Apostolisches Schreiben Laudate Deum, 35). Dies ist eine dringende Aufgabe, die die ganze Menschheit betrifft.
Dieses weite Szenario von Motivationen und Zielen ist auch der Horizont Ihrer Versammlung und Ihrer Arbeit, liebe Mitglieder der Akademie für das Leben. Ich vertraue Sie der Fürsprache Marias an, Sitz der Weisheit und Mutter der Hoffnung: »Als pilgerndes Volk, als Volk des Lebens und für das Leben, gehen wir vertrauensvoll auf ›einen neuen Himmel und eine neue Erde‹ (Offb 21, 1) zu« (Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae, 105).
Ihnen allen und Ihrer Arbeit erteile ich von Herzen meinen Segen.
Rom, aus der Gemelli-Klinik, 26. Februar 2025
Fußnote
1Zit. bei B. De Solanges, Teilhard de Chardin, Témoignage et étude sur le développement de sa pensée , Toulouse 1967, 54.
Copyright © Dikasterium für Kommunikation